Browse in the Library:
Die Sprache des Jazz
So wie er seine eigene musikalische Stimme entwickelt hat, hat der Jazz auch sein eigenes Vokabular hervorgebracht. Viele der Ausdrücke, die das amerikanische Englisch von seiner Muttersprache aus definieren, stammen aus der afrikanisch-afrikanischen Gemeinschaft und insbesondere von Jazzmusikern.
Louis Armstrong erfand oder spielte eine große Rolle bei der Popularisierung vieler davon. Die große Mehrheit ist jedoch nicht spezifisch musikalisch und wird daher nicht in dieses Glossar aufgenommen.
Hier haben wir mehrere Dutzend Begriffe, denen Sie beim Lesen über die Musik begegnen werden – viele davon sind weitgehend selbsterklärend, und andere, die ein wenig zusätzlicher Klärung bedürfen.

Von Anfang an verwendeten die meisten Jazzmusiker dieselbe Terminologie wie andere einheimische amerikanische Musiker, wobei die Begriffe direkt von europäischen Modellen übernommen oder übernommen wurden. Und mit zunehmender Zahl von Spielern, die eine formale Ausbildung erhalten, wird die Anpassung von Begriffen normalerweise übertrieben und der alte Jazz-Jargon wird seltener.
Zu oft ist die Wahrnehmung einer separaten musikalischen Sprache der Jazzterminologie mit einem Aspekt der Herablassung gegenüber der Musik oder mit latentem Rassismus oder einfach mit dem einfachen alten kulturellen Minderwertigkeitskomplex verbunden, der immer noch viele amerikanische Wahrnehmungen über amerikanische Kunstformen plagt.
A cappella: Wird ohne Begleitung aufgeführt.
AABA: Eine gebräuchliche Liedform – normalerweise zweiunddreißig Takte lang, unterteilt in vier achttaktige Segmente – die aus einem musikalischen Thema (A) besteht, das zweimal gespielt wird, gefolgt von einem zweiten Thema (B), das einmal gespielt wird, gefolgt von a Wiederkehr des ersten Themas.
Arco: Bezieht sich auf ein Saiteninstrument, das mit einem Bogen gespielt wird.
Arrangement: Die Überarbeitung einer Komposition für eine bestimmte Gruppe oder einen Interpreten.
Atonal: ohne festgelegte Tonart oder tonales Zentrum.
Beat: Die grundlegende metrische Einheit eines Musikstücks; worauf Sie mit dem Fuß tippen.
Bitonal: Wird in zwei Tonarten gleichzeitig gespielt.
Blaue Note: Ein Ton, der einem Moll-Modus entlehnt und in einer Dur-Tonart verwendet wird. Der Effekt schwingt sowohl ästhetisch als auch musikalisch mit, da die Assoziation mit Moll-Klängen „traurig“ ist, während die Assoziation mit Dur-Klängen „glücklich“ ist.
Blues: Eine afroamerikanische Musikform, deren Standardlänge zwölf Takte beträgt. In seiner frühen Vokalform bestand es aus einer viertaktigen Frage, wiederholt und einer viertaktigen Antwort.
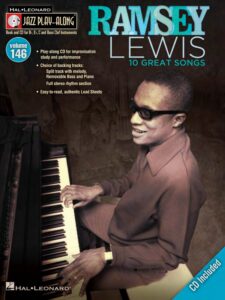
Ein Blues-orientierter Klavierstil, der durch rollende Figuren der linken Hand gekennzeichnet ist – wobei der linke kleine Finger zuerst die Note spielt und mit dem linken Daumen beantwortet wird – und sich wiederholende Riffs in der rechten Hand.
Pause: Wenn die Rhythmusgruppe aufhört zu spielen und ein oder mehrere Instrumente die Lücke füllen.
Bridge: Der B-Abschnitt einer AABA-Komposition.
Kadenz: In einer Aufführung ein Abschnitt, in dem das Tempo stoppt und der Solist ohne Begleitung spielt.
Änderungen: Die Akkorde, die die harmonische Struktur eines Songs definieren.
Refrain: Einmal durch eine Liedform.
Chromatisch: Aufnahme von Noten außerhalb einer Grundtonart oder -tonalität.
Comping: Die Begleitung eines Instruments der Rhythmusgruppe zu einem Solo – bezieht sich normalerweise auf die Funktion eines Akkordinstruments (Piano, Gitarre oder Vibraphon), kann aber auch auf andere angewendet werden.
Konsonanz: Musikalische Klänge, die sich aufgelöst anfühlen.
Kontrapunkt: Das gleichzeitige Auftreten zweier unterschiedlicher Melodien; im weiteren Sinne ein Kontrastpunkt.
Diatonisch: Bezieht sich auf die Noten, die in den grundlegenden Dur- und Moll-Tonleitern einer bestimmten Tonart vorkommen.
Dissonanz: Musikalische Klänge, die sich ungelöst anfühlen und Auflösung suggerieren.
Double time: Ein Tempo, das doppelt so groß ist wie die standardmäßige rhythmische Basis eines Stücks.
Downbeat: Der erste Schlag eines Taktes; auch jeder Rhythmus, der auf dem Schlag auftritt.
Fake: Improvisieren.
Frontline: Die Bläsersektion einer Band, die normalerweise mit Musik aus New Orleans in Verbindung gebracht wird.
Gig: Ein musikalisches Engagement.
Glissando: Das Auf- oder Abgleiten zu einer bestimmten „Ziel“-Note, ohne dabei die Noten klar zu artikulieren.
Harmonie: Zusammenfluss von zwei oder mehr Tönen.
Kopf: Die Melodie eines Stückes.
Kopfarrangement: Eine Interpretation eines Stückes, die vor Ort komponiert und nicht niedergeschrieben wird.
Horn: Jedes Instrument, das durch ein Mundstück gespielt wird.
Zurückgelegt: Bezieht sich auf ein rhythmisches Gefühl, das leicht hinter der tatsächlichen metronomischen Platzierung des Beats zurückbleibt; normalerweise im Gegensatz zu „on top“.
Lead: Die primäre Melodielinie einer Komposition.
Lead Sheet: Ein Musikmanuskript, das die Melodie und Harmonie eines Stücks enthält.
Legato: Eine Art, Noten zu phrasieren, bei der einzelne Noten nicht separat artikuliert werden.
Lick: Eine melodische Phrase.
Melodie: Die Abfolge einzelner Noten, die die Grundform einer Komposition definieren.
Metrum: Die rhythmische Basis einer Komposition.
Modus: Die sieben Tonleitern, die auf allen weißen Noten des Klaviers gespielt werden können, beginnend mit einer Note bis zur nächsten Oktave.
Modulation: Der Wechsel von einer Tonart oder einem Modus zu einer anderen.
Motiv: Eine musikalische Einheit, die durch Wiederholung und Entwicklung als Grundlage für die Komposition dient.
Dämpfer: Ein Gerät, normalerweise Holz, Faser oder Metall, das in den Schallbecher eines Instruments eingesetzt wird, um dessen Ton zu verändern.
Obbligato: Eine Melodie, die die Hauptmelodie begleitet.
Off-Beat: Ein Rhythmus, der nicht auf dem Downbeat platziert ist.
Oben: Bezieht sich auf ein rhythmisches Gefühl, das mit der metronomischen Platzierung des Beats übereinstimmt; wird normalerweise im Gegensatz zu „entspannt“ verwendet.
Ostinato: Eine wiederholte Phrase, die normalerweise in einem niedrigeren Register gespielt wird und als Begleitung dient.
Out chorus: Der letzte Refrain einer Jazz-Performance.
Phrase: Eine melodische Sequenz, die eine vollständige Einheit bildet.
Pizzicato: In Anlehnung an ein Saiteninstrument, mit den Fingern gezupft.
Polyrhythmus: Die gleichzeitige Verwendung von gegensätzlichen rhythmischen Mustern.
Echtes Buch: Eine Sammlung von Bleiblättern.
Register: Der spezifische Bereich eines bestimmten Instruments oder
Stimme – normalerweise hoch, mittel oder niedrig.
Rhythmus: Das Gefühl von Bewegung in der Musik, basierend auf Regelmäßigkeits- oder Differenzierungsmustern.
Rhythmusgruppe: Jede Kombination aus Klavier, Gitarre, Bass-Vibes und Schlagzeug (oder verwandten Instrumenten), deren grundlegende Aufgabe darin besteht, eine Band zu begleiten.
Riff: Eine wiederholte, normalerweise kurze, melodische Phrase.
Rim Shot: Ein Schlag, der von einem Schlagzeuger mit einem Stock gegen die kleine Trommel geschlagen wird (normalerweise auf dem zweiten und vierten Schlag eines Taktes).
Rubato: Ein Musikinstrument, bei dem sich der Solist frei über einem regelmäßig festgelegten Tempo bewegt. Der Begriff wird auch verwendet, um eine vorübergehende Unterbrechung des regulären Tempos eines Stücks zu implizieren.
Sideman: Musiker, der von einem Bandleader angeheuert wird.
Solo: Eine Episode, in der ein Musiker das Ensemble verlässt und alleine spielt.
Untertitel: Leise.
Staccato: So artikuliert, dass jede Note getrennt wird.
Stomp: Eine swingende Darbietung.
Geradeaus: Wird im konventionellen Jazz-Format aufgeführt – 4/4-Takt, Thema-Solo-Thema und eine liedartige Gesamtstruktur.
Tag: Ein verlängertes Ende eines Stücks, normalerweise vier oder acht Takte lang, das die Schlusskadenz wiederholt.
Tempo: Die Rate, mit der der Beat gespielt wird.
Thema: Die zentrale melodische Idee einer Komposition.
Klangfarbe: Die charakteristische Klangfarbe eines Instruments oder einer Gruppe von Instrumenten.
Vamp: The section of a tune where the harmonies are repeated, usually as an introduction or an interlude.
Variation: The development of a theme.
Vibrato: The alteration of a tone’s pitch, from slightly above that pitch to slightly below, usually used as an expressive device.
Voicing: Die spezifische Reihenfolge, in der ein Komponist die Noten eines Akkords gruppiert; auch die Zuordnung dieser Noten zu bestimmten Instrumenten.

Spielarten des Jazz
Bob :
Jede Musik ist an ihren kulturellen Kontext gebunden, und Bop (auch bekannt als Bebop) ist untrennbar mit den sozialen Problemen der frühen 1940er Jahre verbunden, als sich junge schwarze Musiker gegen die schädlichen Überreste des Minnesängers abgrenzten, die tief in der Populärkultur vergraben waren. Sie verhielten sich nicht nur anders, sondern ihre Musik hatte im Kontext ihrer Zeit einen Hang zur Dissonanz, den viele als abstoßend empfanden. Die geradlinigen Melodien, die das Beste des amerikanischen Popsongs auszeichneten, waren größtenteils verschwunden.
Im Gegensatz zu früheren Jazzstilen schien ein Großteil des Bop eine „Nimm es oder lass es“-Einstellung zu haben, wenn es um Massenattraktivität ging. Und in dieser Hinsicht grenzte sie sich an andere zeitgenössische Kunstformen anderer Genres an. Dies spielte natürlich beiden Zielgruppen in die Hände – denjenigen, die „hip“ und auf etwas Neues sein wollten, und denjenigen, die sich gerne ausgeschlossen fühlten.
Bop war im Grunde eine Instrumentalmusik, obwohl es sein vokales Subgenre gab (mit noch mehr unsinnigen Silben und Affekten als die schlimmsten Exzesse der Swing-Ära).
Die Rhythmusgruppen spielten offenkundig aggressiver als zuvor, wobei der Schlagzeuger dazu neigte, zu dominieren und den allgemeinen Fluss der Begleitung zu formen.
Das Bop-Vokabular wurde größtenteils wörtlich aus den Soli des Saxophonisten Charlie Parker und des Trompeters Dizzy Gillespie übernommen und schwelgte in kantigen melodischen Formen („Shaw ‘Nuff“ und „Salt Peanuts“).
Diese Soli zeichneten sich durch eine große Reichweite, saubere und virtuose Darstellung der Technik, eine Vorliebe für ungelöste Akkordwechsel und ein Gefühl großer Dringlichkeit aus. Das soll nicht heißen, dass diese Eigenschaften auch in früherer Musik nicht zu finden sind – natürlich sind sie das –, aber es ist eine Frage der Proportionen. Und genauso wie es eine Weile dauerte, bis Armstrongs Innovation auf die nächste Generation übersickerte, waren viele der ersten Versuche, den Stil von Parker und Gillespie einzufangen, unausgereift.
Zu den ersten, die sich effektiv mit ihrer neuen Musik auseinandersetzten, gehörten die Trompeter Miles Davis und Fats Navarro, der Posaunist JJ Johnson, die Tenorsaxophonisten Warded Gray und Sonny Rollins, die Pianisten Bud Powell und Dodo Marmarosa, der Vibraphonist Milt Jackson, die Bassisten Oscar Pettiford und Charles Mingus sowie die Schlagzeuger Max Roach und Roy Haynes.
Bop war im Wesentlichen eine Kleingruppenmusik (obwohl Gillespie mehrere Jahre lang tapfer versuchte, eine Big Band zu unterhalten), die von ein paar Hörnern und einer Rhythmusgruppe aus Klavier, Bass und Schlagzeug gespielt wurde. Es gab kaum Arrangements oder Zwischenspiele – nachdem das Thema einmal ausgesprochen war, folgte eine Reihe von Soli, wobei das Thema am Ende ohne Variation wiederholt wurde. Mit diesem Verzicht auf das kompositorische und ensemblehafte Element wurde eine viel höhere Anforderung an die einzelnen Solisten gestellt.
Nur wenige der Akolythen von Parker und Gillespie hatten ein vergleichbares Genie, und die meisten konnten das Interesse nicht über längere Zeit aufrechterhalten. Aber diejenigen, die eine neue Elektrizität und Risikobereitschaft in die Musik bringen könnten, könnten aufregend sein. Es ist eine ausgesprochen unsentimentale Musik, aber Bop in seiner konzentriertesten Form fehlt es nicht an Emotionalität.
Es gab diejenigen, die das Beste der Swing-Ära mit dem neuen Vokabular vermischten, und sie neigten dazu, Komponisten/Arrangeure zu sein. Tadd Dameron und Gil Evans fanden Wege, die neuen Klänge in Arrangements zu verweben, die ein gewisses Gleichgewicht zwischen dem Ensemble und dem Solisten wiederherstellten. In vielerlei Hinsicht bildete ihre Musik eine Brücke zwischen den aggressiven Extremen einiger früher Bop-Musik und dem coolen Jazz, der folgen sollte.
Best Sheet Music download from our Library.
Bossa Nova:
In den frühen 1960er Jahren, in den schwindenden Tagen der Prä-Beatles-Musikwelt, gab es einige helle Momente, in denen sich die Popmusik der Art von Raffinesse näherte, die in den 30er und frühen 40er Jahren als selbstverständlich angesehen wurde. Der Bossa-Nova-Wahn der 60er war einer dieser Momente.
Es wurde von einer Handvoll junger Komponisten und Instrumentalisten in Südamerika geleitet, die, inspiriert vom Pianisten und Komponisten Gerry Mulligan und anderen Jazzautoren, danach strebten, das Beste des modernen Jazz mit ihrer eigenen rhythmisch treibenden einheimischen Musik zu kombinieren. In den späten 50er Jahren sorgte die Partnerschaft des Gitarristen/Sängers Joao Gilberto und des Komponisten Antonio Carlos Jobim mit ihrer Zusammenarbeit auf „Chega de Saudade“ für ziemliches Aufsehen in Brasilien.
Die Rhythmen waren Nachkommen des brasilianischen Samba und wurden häufig durch den Einsatz von Akustikgitarren akzentuiert. Obwohl es Andeutungen auf kommende Dinge und eine Kreuzung zwischen Jazz und brasilianischer Musik gab, dauerte es bis der amerikanische Gitarrist Charlie Byrd den Saxophonisten Stan Getz bat, das mittlerweile klassische Album Jazz Samba aufzunehmen, dass Bossa Nova („Neue Welle“ auf Portugiesisch) wurde gestartet. Getz wurde aufgrund seiner nachfolgenden Alben zu einer internationalen Attraktion, wobei sein größter Hit Jobims „The Girl from Ipanema“ war.
Die intime, fast gesprochene Stimme von Gilbertos Frau Astrud spielte eine große Rolle für den Erfolg dieser Aufnahme.
Obwohl seine Popularität nachgelassen hat, gibt es immer noch ein großes Publikum für Bossa Nova, und es nimmt weiterhin einen bedeutenden Platz auf dem Jazzmarkt ein. Zwei herausragende Alben des Genres sind „Big Band Bossa“ von Stan Getz und „Native Dancer“ des Saxophonisten Wayne Shorter (mit Milton Nascimento).
Chicago-Jazz:
Die Anwesenheit von New Orleans-Meistern im Chicago der 20er Jahre wie King Oliver, Louis Armstrong und die Dodds Brothers (Klarinettist Johnny und Schlagzeuger Baby) hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf eine Gruppe junger, weißer Musiker, die ihren eigenen Jazz finden wollten Stimmen.
Ihre Bemühungen spiegelten eher die berauschende Atmosphäre ihrer Heimatstadt wider als die vom Blues inspirierten Reflexionen von Oliver und Co. Die wichtigste Tatsache über die Austin High Gang (einige von ihnen besuchten diese Institution) war, dass ihre Vorbilder Afroamerikaner waren. Aus dieser Gruppe gingen die Klarinettisten Frank Teschemacher und Benny Goodman hervor; die Schlagzeuger Dave Tough, Gene Krupa und George Wettling; und der Kornettist Muggsy Spanier.
(Schwarze Youngsters wie die Schlagzeuger Sidney Catlett und Lionel Hampton und der Bassist Milt Hinton waren auch in Chicago dabei und haben von denselben Männern abgeholt – werden aber bequemerweise von denen übersehen, die den Begriff „Chicago Jazz“ verwendeten.)
In späteren Jahren wurde der Bandleader/Gitarrist Eddie Condon zur Personifikation der Chicagoer Schule. Er hatte eine schnelle Auffassungsgabe – und über die Hüpfer sagte er: „Sie verlieren ihre Fünftel; we drink ours“) – und lange Zeit viel Arbeit gemacht. Aber nichtsdestotrotz blieb dieser Stil für die Handvoll Superlativspieler, die seine Hauptvertreter waren, einschränkend.
Musiker wie Pee Wee Russell, Roy Eldridge, Buck Clayton, Bud Freeman, Vic Dickenson, George Wettling und viele andere verbrachten den Großteil ihrer späteren Karriere unfairerweise in dieser Kategorie. In den seltenen Fällen, in denen diesen Musikern die Möglichkeit gegeben wurde, ein vielfältigeres Repertoire mit Musikern unterschiedlicher Stilrichtungen zu erweitern, waren die Ergebnisse im Allgemeinen aufschlussreich.
Cool Jazz:
„Cool“ ist der Begriff, der verwendet wird, um sich auf die Reaktion auf Bop zu beziehen, bei der seine häufig frenetischen Tempi und leidenschaftlichen Soli durch eine nachdenklichere Haltung ersetzt wurden. Dies wurde normalerweise in moderaten Tempi und in einem Instrumentalstil ausgedrückt, der sich stark an das Beispiel des großen Saxophonisten Lester Young anlehnte, obwohl gesagt werden muss, dass er in geringeren Händen war. Youngs Stil wurde gelegentlich bis zur Unkenntlichkeit verzerrt.
Nichtsdestotrotz war der coole Jazz eine willkommene Abwechslung zum raschen Verfall des Bop-Stils in minderwertigen Händen. Und in den Händen von Meistern wie dem Trompeter Miles Davis, dem Baritonsaxophonisten Gerry Mulligan und dem Pianisten Dave Brubeck war es eine Sache von großer Schönheit.
Die Ursprünge des Stils, der in den späten 1940er Jahren entstand, können auf Claude Thornhiirs Big Band zurückgeführt werden, ein Ensemble, das Klarinetten, Waldhörner und Tuba bevorzugte. Viele junge Musiker (die sich um den Saxophonisten Charlie Parker und den Trompeter Dizzy Gillespie gedreht hatten) waren von dieser Klangfülle und den innovativen Arrangements angezogen, die Gil Evans für die Band schrieb und Elemente aus der klassischen Musik an Jazz-Enden anpasste.
Mit Davis als primärer Kraft gelangten Evans und andere (Trompeter John Carisi, Pianist John Lewis und Bariton-Saxophonist Mulligan) zu einer eigenen Band, die die kleinstmögliche Anzahl an Instrumenten verwendete, um die gewünschten Klangfarben zu erzielen – Trompete, Posaune , Altsaxophon, Baritonsaxophon, Waldhorn, Tuba, Klavier, Bass und Schlagzeug.
Die Soli wurden auf Ellingtonsche Weise in das Ensemble integriert, was die Spieler zwang, kompositorisch zu denken („Boplicity“, „Moon Dreams“ und „Jeru“). Der dynamische Bereich der Band war breit, aber die Gruppe schrie nie und funktionierte am besten bei einem mittleren bis mittelweichen Pegel, der alle Instrumente glänzen ließ.
Obwohl die Band ein kommerzieller Flop war und kurz nach ihrem Debüt zusammenbrach, wurden ihre Aufnahmen (ursprünglich 78er) im Jahr darauf als frühe LP mit dem Titel The Birth of the Cool neu aufgelegt – und der Name blieb.
In den nächsten Jahren wurde praktisch jeder neue Jazzstil, der nicht offen bopartig war, als cool eingestuft.
Dieser ziemlich große Schirm deckte die Musik von Lennie Tristano, Dave Brubeck und Mulligan ab, die alle, wie die Musiker von Birth of the Cool, Lester Young als Inspiration teilten – aber jeder von ihnen kam zu radikal unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, der Sound ihrer Bands hatte eine oberflächliche Gelassenheit, und in Bezug auf Parker und Gillespie waren sie vielleicht „cool“, aber das ist auch schon alles.
Dixieland-Jazz:
Die meisten Fehlinformationen, die dem New Orleans Jazz widerfahren sind, stammen aus dem, was als „Dixieland“-Jazz bekannt geworden ist. Hier lag der Schwerpunkt auf Banjos, Strohhüten, einer knappen und oft unswingenden Phrasierung und Hokuspokus. Mitte der vierziger Jahre begann eine Gruppe weißer Musiker an der Westküste, die Musik des Kornettisten King Oliver und anderer nachzuahmen, und dies führte zu einer Wiederbelebung von „New Orleans“, deren Hauptvertreter eine Band unter der Leitung von Lu Watters war. Ihre Bemühungen, obwohl gelegentlich amateurhaft, waren aufrichtig und respektvoll gegenüber den Wurzeln ihrer Musik.
Ihre Popularität führte zu einem ganzen Genre des Dixieland-Jazz, das sich der Ausbeutung der oberflächlichen Elemente der Nostalgie verschrieben zu haben schien, während es die künstlerische Essenz im Herzen der Musik, die sie feierten, ignorierte. In seinen kommerziellsten Inkarnationen. Dixieland war im Wesentlichen ein weiterer Aspekt des Minnesängers, da es auf einer Verzerrung eines afroamerikanischen Idioms basierte. Und selbst in seinen harmloseren Formen blieb es für viele Spieler der Superlative eine Art Gefängnis.
Freier Jazz:
Dieses Phänomen der späten 50er und 60er war die ultimative Reaktion nicht nur auf die Komplexität des Bop, sondern auf den gesamten Jazz, der ihm vorausging. Free Jazz – auch Avantgarde genannt – gab die funktionale Harmonie vollständig auf und stützte sich stattdessen auf einen weitreichenden Stream-of-Consciousness-Ansatz für melodische Variationen.
Die Saxophonistin Ornette Coleman war die Inspirationsquelle dieses Genres. Das soll nicht heißen, dass es keine anderen Versuche gab, Akkorde loszuwerden, bevor er auftauchte, aber es war die Art und Weise, wie Coleman es tat, die sich durchsetzte. Zunächst war er ein hervorragender Bluesspieler und seine Band hat immer geswingt.
Seine Melodien reichten von Abstraktionen über Charlie Parker bis hin zu sehnsüchtigen Balladen und Blues. Im Laufe der 60er Jahre öffneten Colemans Entdeckungen die Schleusen für alle Arten von improvisierter Musik, die Free Jazz genannt wurde. Einiges davon war faszinierend, aber zum größten Teil war es Freiheit, die unverdient war und die Spieler von nichts befreite – außer, wie einige bemerkten, davon, kostenlos zu spielen. Ein Musiker verglich Free Jazz mit Tennisspielen ohne Netz.
Aber Colemans Musik war stimmungsvoll, und seine Band konnte sich immer auf eine Reihe klassischer Improvisationen verlassen.
Es gab einen weiteren Strom von Musikern, die direkt oder indirekt mit den späteren Bands des Saxophonisten John Coltrane verbunden waren, der sich dem Free Jazz zuwandte.
Coltrane war von Colemans Musik immens beeinflusst, aber wenn er „frei“ spielte, hatte es ein ganz anderes Gefühl. Als er sich 1967 seinem frühen Tod näherte, gewann man den Eindruck, dass Coltranes Musik mehr und mehr als emotionale Katharsis fungierte und es immer schwieriger wurde, sie an den Maßstäben früherer Jazzmusik zu messen.
Aber was es unendlich faszinierend machte, war sein Hintergrund und was er entschied, nicht so viel zu spielen wie das, was er spielte.
In den 60er Jahren gab es eine Reihe von Saxophonisten, die verschiedene Aspekte des Free Jazz verfolgten, allen voran Albert Ayler und Archie Shepp. Ihre Herangehensweisen waren jedoch radikal unterschiedlich: Ayler beschwor häufig mystische Momente religiöser Besessenheit herauf und klang, als würde er auf seinem Tenorsaxophon in Zungen sprechen, während Shepp, ein Intellektueller, den Rand traditionellerer Formen umwarb, während er außerhalb davon blieb.
Etwas später traten Anthony Braxton und Chicagos Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) auf den Plan, jeder mit eigenwilligen Interpretationen der Jazztradition, die Theater und einen gesunden Sinn für Humor in ihre (manchmal) sengenden Reflexionen über die zeitgenössische Gesellschaft einbezog.
Fusion:
Wie viele bemerkt haben. Jazz ist aus einer Verschmelzung von Stilen entstanden, aber dieser Begriff steht heute für die Verschmelzung von Jazz mit Rock und Funk. Es geschah Ende der 60er Jahre und war unvermeidlich. Jazz hatte schon immer ein gesundes Publikum unter den Jungen, und als jüngere Jazzmusiker, die vom Rock entwöhnt waren, erwachsen wurden, begannen sie, mit „Fusionen“ aus beidem zu experimentieren. Die Figur, die es für das Jazz-Establishment akzeptabel machte, war der Trompeter Miles Davis, der der Hauptanstifter und unbestreitbar der Hauptfaktor für die anfängliche Anziehungskraft dieser Musik war.
Das Album, das das Genre unbestreitbar begründete, war Davis’ Werk von 1969. Bitches Brew und bleibt in vielerlei Hinsicht unübertroffen. Das Problem, das den Großteil der nachfolgenden Fusion-Musik plagte, war, dass die Basis von Rock-Rhythmen im Wesentlichen statisch ist und die Musik ohne die Vorwärtsbewegung des Jazz-Rhythmus ihr Profil verliert. Das soll nicht heißen, dass jeder Jazz auf einem schwingenden 4/4-Takt gespielt werden muss, aber wenn er überhaupt nicht vorhanden ist, kann die Frage nach der Herkunft der Musik heikel werden.
Eine der kreativsten und produktivsten Fusion-Bands war Weather Report, in der der ehemalige Davis-Alumni-Saxophonist Wayne Shorter und der Pianist Joe Zawinul auftraten. Sie brachten einen soliden musikalischen Hintergrund und einen Sinn für Swing in ihre Erkundungen ein, der sich auf alles, was sie taten, auswirkte.
Der E-Bassist/Komponist Jaco Pastorius erlangte in dieser Band Berühmtheit und wurde zu einer analogen Figur wie Charles Mingus in seiner Fähigkeit, alles zu nehmen, was ihm gefiel, und dafür einen Platz in seiner Musik zu finden. Er war auch, wie Mingus, ein wahrer Virtuose auf seinem Instrument, der die Art und Weise veränderte, wie der E-Bass in Zukunft gespielt werden sollte.
Die Headhunters-Band der Keyboarderin Heifbie Hancock orientierte sich Anfang der 70er Jahre wegen ihrer rhythmischen Basis mehr an Soul, Funk und R&B als an Rock und wurde außerordentlich erfolgreich. Seine Aufnahme von „Chameleon“ war ein Riesenerfolg und wurde von vielen Künstlern gecovert. Weitere herausragende Gruppen sind Return to Forever und John McLaughlins Mahavishnu Orchestra, deren Profil näher am Rock lag als die anderen, die aber trotzdem schon früh einige sehr kreative Alben herausbrachten.
Die Neuheit, die durch die Nebeneinanderstellungen erzeugt wurde, die Fusion erzeugten, ließ schnell nach, und in den 1980er Jahren wurde es zu einer kommerziellen Musik, die ernsthaften Jazzhörern kaum zu empfehlen war. Eine der wenigen Gruppen, die das Genre ernst nehmen, war die Elektric Band des Pianisten Chick Corea, deren Aufnahmen aus den späten 80ern und frühen 90ern noch nicht als die neuesten Fusion-Meilensteine angefochten wurden.
Hard Bop:
Wie der coole Jazz war Hard Bop eine Reaktion auf Bop. 1955 versuchten der Schlagzeuger Art Blakey und der Pianist Horace Silver, einen Teil des zuhörenden und tanzenden Publikums einzufangen, der durch die schnellen Tempi und die schiere Virtuosität des Bop „verloren gegangen“ war. Sie erreichten dies, indem sie die meisten Tempi verlangsamten, Elemente früherer Jazzstile mit Elementen der Kirchenmusik vermischten und einen konzertierten Versuch unternahmen, die schwarze Laienbevölkerung zu erreichen, die den modernen Jazz zugunsten von R&B und Soulmusik aufgegeben hatte.
Während der West Coast Jazz größtenteils aus weißen Spielern in Kalifornien bestand, war Hard Bop hauptsächlich aus Afroamerikanern der Ostküste. Hard Bop brachte auch einige Elemente aus der Swing-Ära zurück, mit Arrangements, die Zwischenspiele, Einführungen, Vamps und andere Mittel enthielten, um ein wichtiges kontrapunktisches Element hinzuzufügen. Zu den klassischen Alben gehören Blakeys Moanin und Silvers Songfor My Father.
Hard Bop wurde größtenteils von zwei oder drei Hörnern (Trompete, Tenorsaxophon, Posaune) plus Rhythmusgruppe gespielt. Und etwas Interessantes begann in den späten 50er Jahren, als Blakey und Silver weiterhin die besten jungen Spieler einstellten.
Natürlich hielten sie sich mit den neuesten musikalischen Informationen auf dem Laufenden, die von John Coltrane, Sonny Bollins und anderen heruntergefiltert wurden, und es entstand ein wunderbarer Kontrast zwischen dem eher einfachen, viereckigen Repertoire und den Soli, die in ihren Stücken immer weiter gingen Erkundungen.
Es ist Blakey besonders zu verdanken, dass er diese Art von Experimenten gefördert und seinen Bandmitgliedern die Möglichkeit gegeben hat, ihre eigene Musik zur Bibliothek der Band beizutragen. In den frühen 60er Jahren produzierte er mit dem Trompeter Freddie Hubbard und dem Saxophonisten Wayne Shorter in seiner Band Alben wie Free for All, die ebenso hart swingend wie experimentell sind.
Einer der brillantesten Vertreter des Hard Bop war der Saxophonist Cannonball Adderley, der, nachdem er Ende der 50er Jahre als Mitglied der Band von Miles Davis die Spitze der Jazzwelt erreicht hatte, mit seinem Bruder, dem Kornettisten Nat, ein Quintett bildete. Als begabter Erzähler und Bandleader fand Adderley eine seltene Schnittmenge von Kommerz und Kunst, die ihn bis zu seinem frühen Tod 1975 im Alter von 46 Jahren zu einer führenden Persönlichkeit der 60er Jahre machte. Seine 1966 erschienene Hit-Aufnahme von „Mercy, Mercy, Mercy“ erweiterte die populistischen Tendenzen des Hard Bop bis hin zum „Soul Jazz“.
Kansas City Swing:
Kansas City war in den 20er und 30er Jahren das, was New Orleans in den 1900er und 1910er Jahren gewesen war. Die Stadt war weit offen, und die Musik nahm sowohl die Merkmale ihrer ländlichen als auch ihrer städtischen Natur an. Kansas City Swing basierte auf dem Blues, näherte sich ihm jedoch mit einer neu entdeckten Raffinesse.
Mitte der dreißiger Jahre fand sich Bassist Walter Page, nachdem er jahrelang der Leader seiner eigenen Band und Dreh- und Angelpunkt einer anderen (Bennie Motens) war, in der Rhythmusgruppe von Count Basies Band wieder. Page schaffte es bald, seinen eigenen swingenden Beat auf die anderen Mitglieder der Sektion zu übertragen. Zusammen schufen sie eine Vier-Mann-Einheit, die als Einheit spielte.
Sie swingten hart, aber mit einer Leichtigkeit und Eleganz, die neu für den Jazz waren. Dies ermöglichte es den besten Hornisten von Kansas City, auf neue Weise mit dem Tempo zu spielen. Lester Young, der brillanteste von ihnen, trug dazu bei, die Basie-Band zu einer der besten der Ära zu machen. Sie gingen im Dezember 1936 nach New York, und innerhalb kurzer Zeit wurden sowohl Benny Goodman – der zusammen mit seinem Schwager, dem Produzenten John Hammond, dafür verantwortlich war, die Band aus KC herauszuholen – als auch Duke Ellington Fans .
Andere Gruppen, die die Magie von Kansas City widerspiegelten und die den erfolgreichen Weg nach Osten nach New York schafften, waren Andy Kirk und seine Clouds of Joy und Jay McShanns Band, die Charlie Parker in die nationale Jazzszene brachten. Einer der Gründungsväter des R&B, der direkt zum Rock’n’Roll führte, war der Sänger Big Joe Turner, der seine Karriere als singender Barkeeper im legendären KC-Saloon von Piney Brown begann.
Latin Jazz:
Westindische, karibische und spanische Musik waren alles wesentliche Zutaten für die Entstehung des Jazz in New Orleans. Frühe Blues-Hits wie „St. Louis Blues“ hatte einen „Tango“-Refrain, und viele von Jelly Roll Mortons Stücken bezogen sich auf diese Rhythmen.
Ein wichtiger Wendepunkt ereignete sich im Jahr 1930, als eine Aufnahme einer Rhumba, „El Manisero“, bekannt als „The Peanut Vendor“, der erste afrokubanische Tanz wurde, der bei der breiten amerikanischen Öffentlichkeit populär wurde.
Sowohl Louis Armstrong als auch Duke Ellington nahmen schnell ihre eigenen Versionen auf und beide beschäftigten sich in den 30er Jahren weiterhin mit afrokubanischen Stücken. Tatsächlich komponierte Juan Tizol, ein puertoricanischer Posaunist, der mehr als zwanzig Jahre in Ellingtons Band war, „Perdido“, „Caravan“, „Moonlight Fiesta“, „Conga Brava“ und „Bakiff“ für die Band. Aber der große Durchbruch, der den Weg für eine neue Sprache ebnete, die gleichermaßen afro-kubanisch und Jazz war, kam durch die Bemühungen des Multiinstrumentalisten/Arrangeurs Mario Bauza zustande.
Als klassisch ausgebildeter kubanischer Musiker spielte er zunächst in der Band von Chick Webb und lernte 1939 bei der Zusammenarbeit mit Cab Calloway den jungen Trompeter Dizzy Gillespie kennen, der großes Interesse an den Feinheiten afrokubanischer Musik zeigte.
Als Gillespie Mitte der vierziger Jahre seine eigene Bigband gründete, machte ihn Bauza (zu dieser Zeit eine Schlüsselfigur in Machitos afrokubanischer Band) mit dem legendären Conguero Chano Pozo bekannt. Dies stellte sich als historische, wenn auch kurzlebige Verbindung heraus (Pozo wurde kurz darauf bei einer Schlägerei in einer Kneipe getötet).
Zusammen nahmen sie 1947 die ersten Latin-Jazz-Meisterwerke auf („Cubano Be“, „Cubano Bop“ und „Manteca“). Kubanische Folge“). In den frühen 50er Jahren hatte Machitos Band Charlie Parker, Gillespie und andere als Gastsolisten, und Latin Jazz war auf dem besten Weg, ein etabliertes Genre zu werden.
Im Laufe der 50er Jahre gab es eine enorme Vielfalt unter den Bandleadern, die im Latin-Jazz-Bereich arbeiteten (Liebhaber bevorzugen eigentlich den Begriff „Afro-Cuban Jazz“).
Tito Puente, der nicht nur ein wunderbarer Vibraphonist, sondern auch ein erfahrener und origineller Arrangeur war, leitete jahrelang eine hochkarätige Band. Seine Musik wurde schließlich als Salsa berühmt, ein kommerzieller Begriff, den er sehr verachtete (er bedeutet „Sauce“), aber es gab keinen Kampf dagegen.
Den Brüdern Charlie und Eddie Palmieri ist es gelungen, seit den 1960er Jahren sowohl populär (zumindest in der lateinamerikanischen Community) als auch enorm künstlerisch zu sein. Beide werden innerhalb des Genres als wirklich brillante Musiker respektiert. Pianist Eddie ist ein experimenteller Pianist/Arrangeur, der im Latin Jazz fast eine mönchartige Figur ist – eines seiner größten Alben ist The Sun of Latin Music. Mongo Santamaria, ein legendärer kubanischer Conguero wie Pozo, hatte Anfang der 60er Jahre mit „Watermelon Man“ den größten kommerziellen Erfolg des Genres. In den letzten Jahren konnten kubanische Musiker gelegentlich in die USA auswandern.
Modaler Jazz:
Ein Modus ist eine Tonleiter. Die gebräuchlichsten sind diejenigen, die im Bereich einer Oktave gebildet werden, indem nur die weißen Tasten des Klaviers verwendet werden. Im modalen Jazz verwenden die Improvisatoren diese Tonleitern anstelle von Akkorden als Futter für ihre Soli. Dies verleiht der Musik einen „horizontaleren“ Klang, erzeugt aber auch ein Gefühl tonaler Starrheit, das für Zuhörer mindestens so anstrengend sein kann wie zu viele Akkorde. Aber in den Händen des Pianisten Bill Evans, des Trompeters Miles Davis, des Saxophonisten John Coltrane oder des Pianisten George Russell bot modaler Jazz eine neue Möglichkeit des Ausdrucks für Spieler, die eine Pause vom abgedroschenen musikalischen Vokabular brauchten.
Vorahnungen und Experimente mit modalem Jazz gab es zwar schon vorher. Miles Davis’ Kind of Blue von 1959 brachte es mit einer Handvoll klassischer Darbietungen einem großen Publikum näher. Manche Solisten beschränkten sich beim Improvisieren nicht ausschließlich auf die Modi, aber die modale Basis mancher Kompositionen machte sie so unterschiedlich. Eine weitere wichtige Komponente für den Erfolg dieser Aufnahme war, dass alle Spieler Meister der Feinheiten der diatonischen Jazz-Harmonie waren und ihre Beherrschung dieser Ausdrucksweise in ihre modalen Erkundungen einbrachten.
Spätere Improvisatoren, die diese Erfahrung nicht gemacht hatten, waren nicht in der Lage, sich in der modalen Sprache melodisch zu profilieren, was zu einer Flut von eher uninspirierten Darbietungen führte. „Impressions“ von John Coltrane und „So What“ von Davis sind die Quintessenz modaler Stücke mit einfachen, skalaren Melodien. Dieser Stil stellte eine besondere Herausforderung für die Gitarristen, Pianisten und Vibraphonisten dar, die nicht auf ihre gewohnten Voicings und Progressionen zurückgreifen konnten, ohne anachronistisch zu klingen.
New-Orleans-Jazz:
Die klassische Formation aus Trompete, Klarinette, Posaune, Klavier, Gitarre oder Banjo, Tuba oder Bass und Schlagzeug repräsentiert die definitive New Orleans Jazzband, obwohl eine beliebige Anzahl und Vielfalt von Instrumenten die Musik spielen kann. Was üblicherweise als „New Orleans Jazz“ bezeichnet wird, erwuchs aus dem reichen musikalischen und kulturellen Erbe seiner kosmopolitischen Heimat. Seine Entstehung nach dem Ersten Weltkrieg war das Produkt vieler Einflüsse. Eine der bedeutendsten kam von den Band-Orchestrierungen der Ragtime-Musik, die im frühen 20. Jahrhundert im ganzen Land blühten.
Die Spieler begannen im Rahmen dieser Arrangements zu improvisieren, und daraus entstand die raue und spontane Form, die sich Mitte der 1910er Jahre schnell zu dem entwickelte, was als Jazz bekannt wurde.
Es gibt viele Erklärungen dafür, wie genau dies geschah und welche Musiker die Schlüsselbewegungen waren. Buddy Boldens Band aus dem Jahr 1905 scheint ein Hauptfaktor bei der Verbreitung einer neuen Art von Blues-basierter Instrumentalmusik in New Orleans gewesen zu sein, die bald von der nächsten Generation von Spielern entwickelt werden sollte.
Aber was wir von den ersten definitiven Aufnahmen des Genres wissen, die 1923 von King Oliver’s Creole Jazz Band gemacht wurden, ist, dass eine Generation von Musikern zu einer wunderbaren Art gekommen war, zusammen zu spielen und eine rockige und rollende Musik zu erzeugen (mit a swingender 4/4-Takt und eine Basis im Blues). Ihre Konzeption ist bis heute die Wurzel des Jazz.
New Orleans Jazz ist grundsätzlich kontrapunktisch, das heißt, verschiedene Melodien spielen gleichzeitig gegeneinander. Obwohl Solos eine Rolle spielen, wird die Essenz der Musik durch das Zusammentreffen vieler gleichzeitig spielender Personen übertragen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen. Tatsächlich treten sie sich nicht nur nicht gegenseitig auf die musikalischen Zehen, sondern ein Großteil der Magie kommt von den Bürsten und Reibungen, die zwischen den Instrumenten auftreten. In diesem Sinne ist jeder Spieler ein Komponist seiner eigenen Linie in einer spontan entstandenen Komposition.
Dies führte schließlich zur Befreiung einer der Linien in ein herausragendes Solo, und genau dieser Aufgabe widmete Louis Armstrong sein Genie. Er war gleichzeitig der Inbegriff des New Orleans-Musikers und derjenige, der die nächste Ära in der Entwicklung der Musik einläutete. Wegen seines Ensemblecharakters. New Orleans Jazz blieb fest mit dem vorliegenden Stück verwurzelt, und die Soli neigten dazu, melodische Paraphrasen zu sein, die schließlich zu Variationen wurden. Daraus entstand Armstrongs Brillanz und machte schließlich die Variationen selbst zum Ziel.
Die King Oliver Creole Jazz Band von 1923 (mit der Armstrong seine ersten Soli aufnahm) und die Jelly Roll Morton Red Hot Peppers-Sessions von 1926 repräsentieren die Freuden des New Orleans Jazz und offenbaren die enorme Vielfalt der Ansätze, die innerhalb dieses Idioms zu finden sind. So unterschiedlich ihre Musik auch klingen mag, was sie eint, ist, dass alle Instrumentalisten die meiste Zeit gespielt haben und ihre Musik dennoch nie überladen klingt.
So in seinen unzähligen Formen. New Orleans Jazz ist viel abwechslungsreicher als die meisten späteren Jazzstile. Die großen Komponisten – unter ihnen Ellington, Lewis, Mingus, Brookmeyer, Marsalis – haben dies nie vergessen und ihre Musik mit ähnlichen Strukturwechseln gesäuert.
Große Erfolge feierten ab den 1950er Jahren Bands, die sich aus älteren Spielern aus New Orleans zusammensetzten, allen voran der Klarinettist George Lewis und die Preservation Hall Jazz Band. Obwohl sie als „authentisch“ angesehen wurden, bestanden sie größtenteils aus Musikern zweiten Ranges, was der Musik von New Orleans in den Köpfen vieler ein primitives Profil verlieh. Darauf folgten die verfeinerten Bemühungen des Pianisten Bob Greene in den 60er und 70er Jahren, die gut aufgenommen wurden.
Es war jedoch das Auftauchen des Trompeters Wynton Marsalis in den 1980er Jahren und sein Eintreten für die wahren Wurzeln und die Relevanz des Genres, das den Ruhm des New Orleans Jazz weltweit bekannt machte. Er ließ es leben und atmen, ohne auch nur einen Hauch von Antiquariat.
Folglich ist es nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel, dass junge Spieler mit seiner Umgangssprache vertraut sind, und das ist eine wunderbare Sache.
Smooth Jazz:
Smooth Jazz ist eigentlich eine Teilmenge von Fusion, aber er hat in den letzten zehn Jahren ein so enormes Profil gewonnen, dass er eine eigene Überschrift verdient. Es ist im Grunde ein Easy-Listening-Genre. Musiker aller Couleur haben sich in dieses Genre gewagt, vom ungeheuer talentierten Jazzgitarristen George Benson und dem großen Bandleader Bob Mintzer (er ist ein Schlüsselmitglied der Yellow Jackets) bis zu den Saxophonisten Kenny G., Najee und Dave Koz.
Vielleicht war der Musiker, der mehr als jeder andere zur Schaffung des Idioms beigetragen hat, der Saxophonist Grover Washington, Jr., in der Jazzsprache kompetent und nutzte sein Wissen darüber, um seine Ausflüge in die leichtere Musik zu erhellen. Seine Schützlinge haben jedoch selten sein Talent oder sein Gefühl für den Blues.
Soul-Jazz:
In den 1960er Jahren ging der Soul-Jazz in seinem Streben nach einem jungen, urbanen Publikum noch einen Schritt weiter und reduzierte die Komplexität des Bop noch weiter. Es war nicht ungewöhnlich, dass es eine wiederholte Schleife einer Basslinie als „Aufhänger“ für ein Stück gab. Sicherlich war dies zuvor in vielen anderen Jazzstilen verwendet worden, aber auch hier war es eine Frage der Betonung.
Während Art Blakey vom Hardbop durch die von ihm gewählten Sidemen mit den neuen Klängen des Jazz in Kontakt blieb, spielte der Pianist Horace Silver die „funkige“ Natur seiner Musik hoch und beeinflusste eine ganze Generation von Musikern, von denen einige anderen Bands große Hits bescherten , einschließlich des Klassikers „Moanin“ des Pianisten Bobby Timmons für die Blakey-Band.
Dann gab es Mitte der 50er Jahre den Auftritt des Organisten Jimmy Smith und seine Reihe von Hit-Alben, die seine Beherrschung der Charlie-Parker-Sprache mit einer Vorliebe für „Soul“ und Spuren von R&B verbanden. Der Blues (als Form, nicht als Inspiration) spielte im Soul-Jazz eine viel größere Rolle als im Hardbop, und Orgeltrios mit Gitarre und Schlagzeug tauchten in Clubs im ganzen Land auf.
Aus diesem Milieu kamen große Talente wie die Gitarristen George Benson und Grant Green; die Organisten Shirley Scott, Jimmy McGriff und Richard „Groove“ Holmes; und die Saxophonisten Stanley Turrentine und Eddie Harris.
Damals, als Jazz Teil des Mainstreams der Popmusik war, konnten Armstrong, Ellington und andere Werke schaffen, die das Potenzial hatten, Zuhörer zufrieden zu stellen, die zur Musik kamen und reine Kommerzialisierung oder reine Kunst (oder eine Kombination davon) erwarteten.
Als Soul-Jazz Mitte der sechziger Jahre zu einer Ware wurde, kämpften die Überreste von Jazz und R&B einen aussichtslosen Kampf gegen die vordringende Hegemonie des Rock ‘n’ Roll, damals in seiner englischen Inkarnation. Obwohl einiges davon durchaus lobenswert ist, hat wenig Soul-Jazz den Status eines „Klassikers“ im Pantheon des Jazz erreicht.
Stride:
Diese zweihändige Herangehensweise an das Jazzpiano basiert auf einer starken, gleichmäßigen Begleitung in der linken Hand, die zwischen einer tiefen Bassnote und einem Antwortakkord wechselt, der etwa eine Oktave höher gespielt wird. Es ist die Anstrengung, die unternommen wird, um diese manchmal schwierigen Sprünge zu machen, die zu dem Namen „Schritt“ geführt hat. Die rechte Hand trägt im Allgemeinen die melodische Führung.
Die große Herausforderung besteht darin, dieses „Handful of Keys“ (so heißt eine Stride-Komposition von Fats Waller) anzugehen und zum Schwingen zu bringen. Dies ist die Musik eines Virtuosen, da die wesentliche Natur dieses Klavierstils orchestral ist.
Kontrapunkt, Rhythmus- und Registerwechsel müssen irgendwie nicht durch Hörner, sondern durch Manipulation mit zehn Fingern erreicht werden. Und während die wesentlichen Hornisten des frühen Jazz in New Orleans ansässig waren, landeten die Männer, die das Jazzklavier erfanden, größtenteils in und um New York City.
Die Ragtime-Pianisten Eubie Blake und Luckey Roberts waren großartige Virtuosen und Songwriter, und ihre Erweiterung der Ragtime-Grenzen in den 1910er Jahren deutete auf einen neuen Stil hin. James P. Johnson, der dort weitermachte, wo sie aufgehört hatten, wurde zu Recht als „Vater des Stride Piano“ bezeichnet, und aus seinen Innovationen der frühen 1920er Jahre floss die große Mehrheit der Jazz-Piano-Stile hervor.
Während Ragtime keine improvisierte Musik war, wurde Johnson für seine Fähigkeit bekannt, Variationen zu einem Thema zu entwickeln, die dreißig Minuten und länger dauerten. Seine frühen aufgenommenen Soli und Klavierrollen (insbesondere „Carolina Shout“) wurden zum grundlegenden Text, der Duke Ellington und zahllosen anderen beibrachte, wie man einen Klavierschwung macht.
Und durch Johnsons Schüler Thomas „Fats“ Waller bekommen wir eine direkte Verbindung zu Count Basie. Waller war ein noch raffinierterer Pianist als Johnson, und obwohl er viele Hits komponierte und ein großer Star wurde, bewegte er sich in künstlerischer Hinsicht innerhalb der von Johnson geschaffenen Sprache. Eine weitere Schlüsselfigur war
Willie „The Lion“ Smith, der sich mehr als die anderen für harmonische Variationen interessierte, sollte auch großen Einfluss auf Ellington haben.
Was alle diese Männer gemeinsam hatten, war die Fähigkeit, aus dem stetigen Schlag ihrer linken Hand und den unerbittlichen melodischen Variationen ihrer rechten Hand ein massives Gefühl von Swing zu erzeugen. Da sie häufig vor großen Gruppen von Menschen spielen mussten, ohne jemanden auf dem Musikpavillon und ohne Verstärker, waren sie für ihre überlebensgroßen Persönlichkeiten und ihre großartige Show bekannt.
Und obwohl es nur wenige waren, gab es Spieler, die diese anspruchsvolle Tradition über die Jahrzehnte gemeistert haben. Don Ewell schaffte es, sehr kreativ zu sein, während er direkt in der Sprache blieb. Die Musik von Thelonious Monk wurzelte in einer brillant originellen Abstraktion des Stride Piano. (Es ist erwähnenswert, dass er James P. Johnson kannte und gerne hörte, dass er gelegentlich wie er klang!)
Und es ist nur ein Hüpfer, Hüpfer und Sprung vom Monk zum zeitgenössischen Jazz-Piano, also bleibt die Verbindung zur Stride-Tradition lebenswichtig. In den letzten Jahren hat Marcus Roberts einige verblüffende und schwungvolle Aktualisierungen dieses Erbes hervorgebracht.
Swing:
Es dauerte eine Weile, bis die jungen Jazzmusiker der 20er und frühen 30er Jahre mit Louis Armstrong gleichgezogen hatten. Als sie das taten und seine Sprache als Grundlage für ihre eigenen Entdeckungen verwendeten, schufen sie den sogenannten „Swing“-Stil. Dies kam zum Tragen, als nicht nur die Solisten, sondern auch die Rhythmusgruppen (als Einheit) und die Big Bands (als Ensemble) lernten, mit Armstrongs Rhythmusgefühl und Phrasierung zu spielen.
Die Rhythmusgruppe von Count Basie war die erste, die diesen Ansatz perfektionierte, bei dem alle vier Instrumente zu einem zusammenhängenden Ganzen verschmolzen, das größer ist als die Summe seiner Teile. Sicher, es gab auch andere Spieler und Autoren, die ebenfalls ihren Beitrag leisteten, aber es ist unbestreitbar, dass es Armstrongs transformatives Beispiel war, das als Hauptkatalysator für das diente, was folgte: einer dieser zufälligen Momente, in denen Populärkultur mit einer neuen und schnell wachsenden Kultur verschmolz Kunstform, wobei sich beide Elemente gegenseitig inspirieren.
Auch die Interaktion des Swing-Stils mit Tänzern kann nicht überbewertet werden. Als die populären Tänze, die ihre Wurzeln in der schwarzen Gemeinschaft hatten, immer beliebter wurden (ein Trend, der bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückreicht), suchten die Tänzer und die Swing-Musiker einander nach Inspiration. Dies half beiden Gruppen und der dritten Gruppe, die einfach gerne zuhörte und zusah, neue Energie zu tanken.
Pianisten Teddy Wilson und Count Basie; die Saxophonisten Coleman Hawkins, Lester Young und Benny Carter; Klarinettist Benny Goodman; Trompeter Roy Eldridge; Posaunisten Jack Teagarden und Dickey Wells; Schlagzeuger Jo Jones und Sid Catlett; Bassist Walter Page; und der Xylophonist Red Norvo gehörten zu den besten dieser Generation. Sie konnten in jedem Tempo mitsegeln, schwierigen Harmonien gekonnt begegnen, originell mit dem Blues umgehen und Soli beliebiger Länge schaffen, die makellos stimmig und originell waren.
Die Standardformation für ihre Musik war die Big Band. Die Bands von Count Basie, Benny Goodman, Jimmie Lunceford, Claude Thornhill und Duke Ellington waren sicherlich verschieden, aber sie hatten auch viel gemeinsam. Sie fanden einen Weg, eine große Gruppe von Hörnern zu organisieren, die von einer Rhythmusgruppe unterstützt wurden, die ein Gleichgewicht zwischen den komponierten Elementen und den spontanen, improvisierten Teilen aufrechterhielt.
Jede Band variierte die Proportionen, aber alle diese Gruppen folgten die meiste Zeit der gleichen allgemeinen Formel: Das Ensemble spielte die Melodie, wobei Plätze für den Leader offen blieben, damit das Publikum leicht erkennen konnte, um wessen Band es sich handelte; Es folgten Soli oder ein Gesang, wobei die Begleitung eine Reduktion von Armstrong-ähnlichen Phrasen war, gespielt von einer der Bläsersektionen oder einer Kombination aus diesen. Es kann eine Modulation oder ein Zwischenspiel, ein weiteres Solo und dann die kulminierenden Chöre geben, die normalerweise eine hohe Trompete oder Klarinette enthalten.
Obwohl es unzählige Variationen davon gab, ist dies die grundlegende Art und Weise, wie diese Bands ihre Musik präsentierten. Die Arrangeure, die die Musik komponierten, die die Bands spielten, behielten den gleichen kompositorischen Faden bei, der den New Orleans Jazz verband. Aber da ihnen mehr Instrumente zur Verfügung standen und sich die harmonische Basis der Musik immer weiter ausdehnte, hatten sie mehr Möglichkeiten.
Die größten Solisten der Swing-Ära brauchten ein Ventil für ihr Jazzspiel, wo sie sich „ausstrecken“ konnten, und die meisten von ihnen bildeten entweder eigene kleine Gruppen oder etablierten Combos, die sich mit der größeren Gruppe abwechselten. Basies Kansas City 6’s und 7’s (“Lester Leaps In” und “Dickie’s Dream”), die verschiedenen Goodman-Kammergruppen (“After You’ve Gone”, “Dizzy Spells” und “Body and Soul”), die Ellington-Einheiten darunter die Namen seiner Sidemen („C Blues“, „Love in My Heart“ und „Menelik“) und Chick Webbs Chicks („Stompin’ at the Savoy“ und „I Got Rhythm“) machten alle viele klassische Aufnahmen.
Es gab eine Handvoll kleiner Bands, die alleine existierten, von denen die bemerkenswerteste das John Kirby Sextet war. Ihre Musik war gleichzeitig zugänglich und unverwüstlich intelligent, und ihre Popularität führte dazu, dass sie die erste schwarze Band wurde, die ihre eigenen Netzwerk-Radiospots hatte.
Third Stream, Dritter Strom:
Der Jazz steht seit seinen Anfängen im Dialog mit der europäischen Klassik. Die Stride-Pianisten zum Beispiel nahmen oft ein bekanntes klassisches Stück und „jazzten“ es, indem sie die Rhythmen änderten und darauf improvisierten (das war auch ein Aspekt des Ragtime). Komponisten/Arrangeure wie Bill Challis, Eddie Sauter, Billy Strayhorn, Paul Jordan und Bob Graettinger fanden originelle Wege, um Elemente, die direkt aus der klassischen Orchestermusik stammen, in ihre eigene Jazzsprache zu integrieren.
Aber Third Stream als diskretes Phänomen war die Idee des französischen Hornisten/Komponisten/Dirigenten Gunther Schuller. In allen musikalischen Genres zu Hause, versuchte Schuller Mitte der fünfziger Jahre, verschiedene Elemente dieser unterschiedlichen Musiken zu kombinieren – das Ergebnis war ein Stil ohne Grenzen.
Wie er es damals ausdrückte: „Es ist eine Art, Musik zu machen, die besagt, dass alle Musiken gleich geschaffen sind und in einer schönen Bruderschaft/Schwesternschaft von Musiken koexistieren, die sich gegenseitig ergänzen und befruchten. . . . Und es ist die logische Folge des amerikanischen Schmelztiegels: E pluribus unum“.
Die meisten Klassiker des Third Stream kamen kurz nachdem Schuller den Begriff 1957 geprägt hatte. Werke von George Bussell („All About Rosie“), John Lewis („Three Little Feelings“ und „Golden Striker“), JJ Johnson („Jazz Suite for Brass“) und Bill Russo („An Image of Man“) gelang es, die Missverständnisse zu umgehen, die viele künstlerische interkulturelle Amalgame schließlich zum Scheitern bringen.
Obwohl heute nur noch wenig daran erinnert wird, half Schuller John Lewis 1962 bei der Gründung des ehrgeizigen Orchestra USA. Es dauerte drei Jahre, in denen sie Harold Farberman (einer der Mitbegründer), Jimmy Guiffre, Hall Overton und Gary beauftragten McFarland, Benny Golson und Teo Macero unter anderem. Die Band selbst bestand aus vielen erstklassigen Jazz- und Klassikspielern, und zu den vorgestellten Künstlern gehörten Ornette Coleman, Coleman Hawkins und Gerry Mulligan. Bei all dieser Musik erscheint es umso seltsamer, dass die Aufnahmen von Orchestra USA seit den 60er Jahren weitgehend vergriffen sind.
Nur wenige Anhänger der Third-Stream-Philosophie bleiben übrig, vor allem der Pianist/Pädagoge Ron Blake. Aber um die Jahrhundertwende scheint das Genre „Weltmusik“ eindeutig vorweggenommen zu haben. Hier finden wir Raum für die herausfordernden Mischungen musikalischer Kulturen, die der Klarinettist Don Byron, die Saxophonisten Steve Coleman und John Zorn, der Trompeter Dave Douglas und der Gitarrist Bill Frisell geschaffen haben.
West Coast Jazz:
Von allen Labels da draußen ist dies eines der irreführendsten. Denn obwohl viele dieser Spieler an der Westküste lebten, wurden die meisten von ihnen nicht dort geboren; Die Musik, die sie spielten, hatte ihre Wurzeln fest an der Ostküste. Außerdem spielten an der Westküste viele Gruppen von Musikern, deren Spiel nicht in diese Kategorie passt.
Dennoch ist es eine Bewegung, die einen eigenen Kanon etabliert hat. Die mit diesem Stil identifizierten Musiker waren fast ausschließlich Weiße, obwohl ihre wichtigsten Inspirationen schwarze Spieler blieben, von denen viele im Geschäft nicht annähernd so gut abschnitten wie ihre weißen Kollegen. Dies führte zu einer Reihe persönlicher und kritischer Spaltungen, die eine objektive Bewertung ihrer Musik erschwerten.
West Coast Jazz ist ein Subgenre des coolen Jazz. Spieler, die in den Bands von Stan Kenton und Woody Herman gespielt hatten – Trompeter Shorty Rogers, Reedman Jimmy Guiffre, Schlagzeuger Shelly Manne – experimentierten in den 1950er Jahren mit einer breiten Palette von Kompositionsmitteln, die meistens erfolgreich waren und einen willkommenen Kontrast dazu boten die Thema-Soli-Thema-Bop-Formel.
Die unterschiedlich großen Gruppen unter der Leitung des Pianisten Gerry Mulligan (am bekanntesten sein Quartett mit dem Trompeter Chet Baker) und des Saxophonisten Stan Getz galten ebenfalls als Teil dieser Westküsten-Crew, obwohl ihre Musik gleichermaßen mit dem Stil von New Orleans / Kansas City verwandt war Lester Young und die kleinen Bands von Basie und Charlie Parker.
Der Grundsound des West Coast Jazz stammt direkt aus den Miles Davis Nonett- und den Birth of the Cool-Aufnahmen. Die Dynamik wurde relativ niedrig gehalten, und der Schatten des Saxophonisten Lester Young (oder zumindest eines Teils von ihm) schwebte über vielem, was sie taten.
